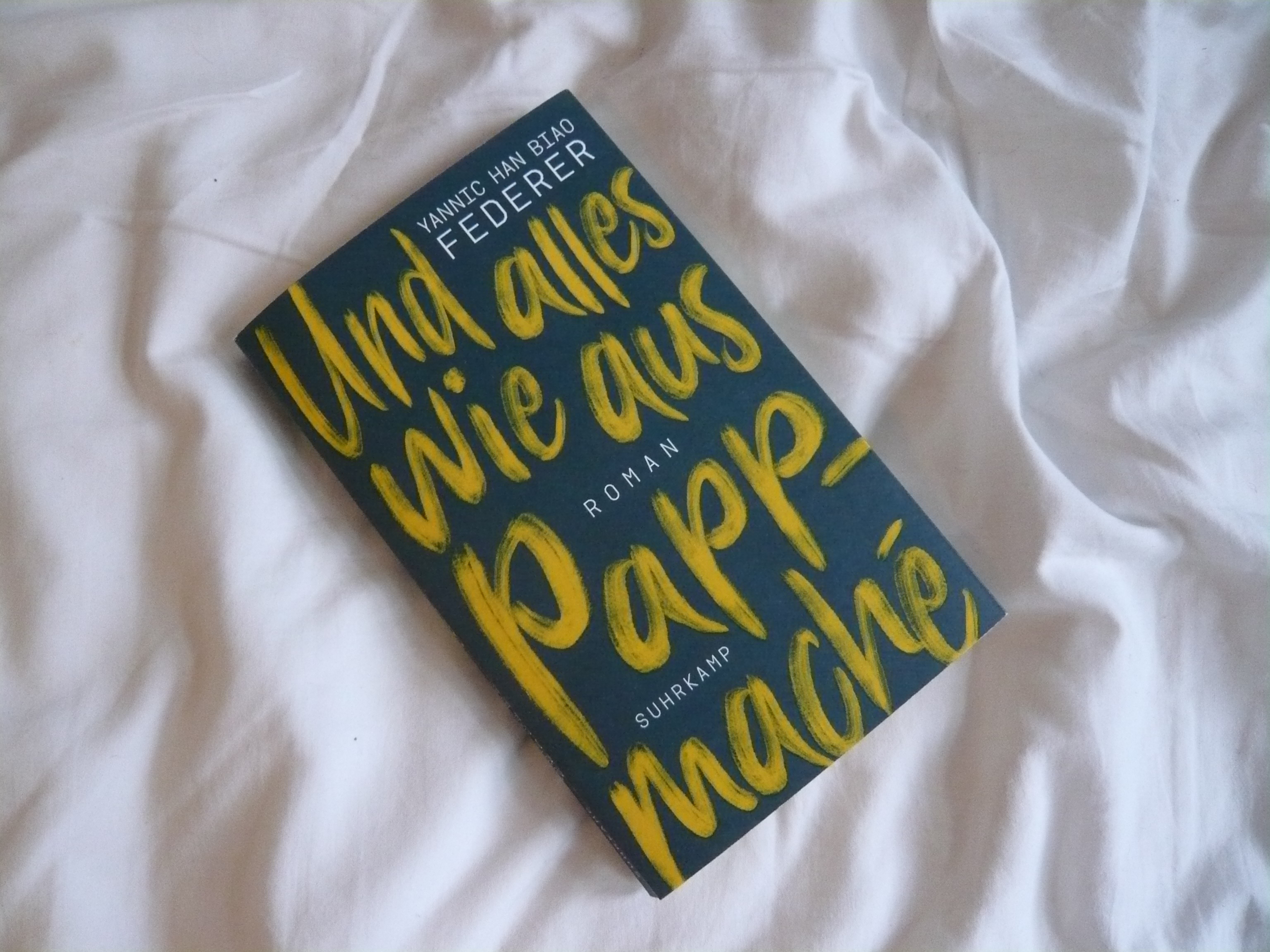»Aber so ist es nicht gekommen, weil es anders gekommen ist« (S. 10)
Dieser Debutroman erzählt von dem Versuch mehrerer junger Menschen, sich und einen Platz in der Welt zu finden und will dabei einiges über die Zeit erzählen, in der wir leben.
Der junge Autor macht dabei eine Zeitspanne von 15 Jahren auf. Beginnend im Jahr 2001 in der Badischen Provinz reicht die Erzählung fast bis in die aktuellste Gegenwart und springt immer wieder zwischen den Figuren und in der Zeit. Schlaglichtartig werden Blicke auf die Menschen einer lose zusammenhängenden Gruppe gewährt, wobei durch massenhaft Realitätspartikel ordentlich 00er-Jahre-Nostalgie aufkommt.
Dabei ist schwer zu sagen, worum es  eigentlich geht. Der Roman gleicht eher einem atemlosen Geplapper ohne wirklichen Plot, das inhaltlich an Telenovelen erinnert. Es geht um Bettgeschichten, Drogen, Wahnsinn und jede Menge Tratsch. Die ursprünglichen Klassenkameraden haben sich irgendwann alle aus den Augen verloren, doch Ich-Erzähler Jian arbeitet sich daran ab, was ihre gemeinsame Geschichte sein könnte. Bis alle Erzählstränge in ein unfreiwilliges Klassentreffen auf einer Beerdigung münden…
eigentlich geht. Der Roman gleicht eher einem atemlosen Geplapper ohne wirklichen Plot, das inhaltlich an Telenovelen erinnert. Es geht um Bettgeschichten, Drogen, Wahnsinn und jede Menge Tratsch. Die ursprünglichen Klassenkameraden haben sich irgendwann alle aus den Augen verloren, doch Ich-Erzähler Jian arbeitet sich daran ab, was ihre gemeinsame Geschichte sein könnte. Bis alle Erzählstränge in ein unfreiwilliges Klassentreffen auf einer Beerdigung münden…
Der Text kokettiert mit einer sehr zerstreuten Art zu erzählen, einer mosaikartigen Gesamtschau, die lose verwobene Momentaufnahmen beleuchtet, die allerdings kein Ganzes ergeben wollen. Auf Zeitebene spielt der Autor mit abwechselnd extremer Beschleunigung und kleinteiligen Konzentrationen. Es scheint, als solle dieses Erzählkonstrukt näher am ›echten‹ Leben sein, in dem es auch keinen sinnvollen Plot, straffen Spannungsbogen oder ein klares Happy End gibt.
Die Alltagsdramen, die sich entspinnen, weisen dafür einen hohen Grad an schicksalhafter Zufälligkeit auf, stellenweise ergeben sich sogar kleine Domino-Effekte, erzählt im Stil eines ›er weiß von dem seiner Schwester, die gehört hat, dass irgendwer vermutet, …‹, was das Ganze irgendwie banal klingen lässt.
Der schmale Roman umspannt die Fragen, wie man geprägt ist von seiner Vergangenheit und Herkunft, und wie es ist, schließlich wieder an diesen Ausgangspunkt zurückzukehren.
»Diese wissenden Blicke, das harmlose Getue. Und dann kommt das Geschrei.« (S. 33)
 Urszene 09/11
Urszene 09/11
Inmitten des erzählten Schwalls an Anbandeleien, Schwärmereien, Suff, Teenie-Muff, Abiball, Homosexualität, verletzten Gefühlen, enttäuschten Erwartungen, Familiendramen und Problemen, ins Erwachsenen- und Berufsleben über zu setzen, steht der 11. September 2001 – der Tag der einstürzenden Twin Tower und der Beginn des systematischen Kampfes gegen Terrorismus – wie ein Fels in der Brandung. Auch wenn das Politische in diesem Roman immer nur im Hintergrund abläuft, nur wie aus dem Augenwinkel wahrgenommen wird, lässt es das erzählte eigene kleine Leid der Figuren noch unwichtiger erscheinen. Sie alle sind sehr auf sich konzentriert, obwohl jeder einzelne eigentlich mit großen (identitäts-)politischen Themen zu tun hat: rechte Gewalt, Bisexualität, Homosexualität, Drogenabhängigkeit, Depressionen, Pegida-Demos, nicht klassische Familienkonstellationen, Ausgrenzung und dergleichen mehr.
Dieser Themenwust wird vom Autor dann in Bandwurmsätze gegossen; in kurze, simple Sätze, die durch und-und-und-Reihungen aneinandergeklebt werden. Federer beweist seine Vorliebe für indirekte Redewiedergabe, Aufzählungen und Wiederholungen und erschafft so einen gewollt unschönen Stil, der absurd sperrig und ungelenk, atemlos ist.
»Einige Tage später sagt Anna, dass Bobby bald zurückkommen werde, woraufhin Mascha fragt, wie sie es ihm sagen wolle, woraufhin Anna sagt, dass sie es ihm nicht sagen wolle, woraufhin Mascha fragt, was sie damit sagen wolle, woraufhin Anna sagt, dass Mascha doch habe wissen müssen, dass das mit ihnen keine Zukunft habe, woraufhin Mascha sagt, dass sie überhaupt nicht habe wissen müssen, dass das mit ihnen keine Zukunft habe, und wie sie darauf komme, dass das mit ihnen keine Zukunft habe, (…).« (S. 28)
Viele Sätze und Kapitel beginnen sogar  mit „und“ – wollen so Teil eines Geflechts sein und tragen zum Eindruck eines mündlichen Plapper-Sprechs, inklusive falscher Grammatik, Jugend-Slang, assoziativer Sprünge, Einschübe und Kleinst-Exkurse bei. Die Erzählhaltung wirkt so distanziert, filmisch, szenisch und atmosphärisch.
mit „und“ – wollen so Teil eines Geflechts sein und tragen zum Eindruck eines mündlichen Plapper-Sprechs, inklusive falscher Grammatik, Jugend-Slang, assoziativer Sprünge, Einschübe und Kleinst-Exkurse bei. Die Erzählhaltung wirkt so distanziert, filmisch, szenisch und atmosphärisch.
»(…) und dann frage ich mich, wie die Dinge wohl gelaufen wären, wenn ich damals Anna nicht beim Spülen geholfen hätte (…)« (S. 10)
Jian kämpft mit dem Schwulsein und damit, nicht richtig deutsch, aber auch nicht chinesisch, geschweige denn indonesisch, zu sein. Seine vertane Chance bei Sarah lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Diese ist mittlerweile ihr Modelleben satt und wird nach gescheiterter Ehe zum Poser-Punk. Anna dagegen, mit der Jian nach einer Party anstatt mit Sarah geschlafen hatte, hat sich in eine bisexuelle Dreiecksbeziehung manövriert. Mascha kämpft mit den rechtskonservativen Ansichten ihres immer aggressiver werdenden Vaters. Tim will Rapper werden. Frank, dessen Mutter in der RAF war, hat mit sich zu tun und zieht sich in den Wald zurück, um dort den Tod zu besuchen. Ein syrischer Kiosk-Verkäufer würde gern im Kampf gegen »die Islamistenwixer« sterben.
Sie alle sind die letzten Nicht-Digital-Natives, in einer Identitätskrise, überfordert von einer atomisierten Welt. Ihr einziger Ausweg scheint das Erzählen zu sein: Narration allein vermag noch Zusammenhänge, Kohärenz und Sinn von parallelen Gleichzeitigkeiten zu stiften. Wo steht man? Wo kommt man her und wo ist das Vergangene hin? Woran kann man festhalten?
»(…) und eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen Leben und Tod, überlege ich, im Tod nistet das Leben und im Leben stirbt man vor sich hin, und wir wollen das nur nicht wissen, (…).« (S. 197)

Nicht unbedingt diese Themen an sich, aber in der Art, wie sie angelegt sind und verhandelt werden, wirken letztendlich ziemlich überflüssig, entbehrlich und wirkungslos. Von dem Titel hatte ich mir einen poetischeren Coming-of-Age-Blick versprochen. Zu viele Figuren und zu viel (Erzähl-)Durcheinander hängen einen bei der Lektüre unterm Strich ab, auch wenn Kleinst-Verflechtungen so langsam einen bruchstückhaften Blick auf das große Bild zulassen.
Fazit: Und, und, und…
Yannic Han Biao Federer portraitiert in seinem Romandebut »Und alles wie aus Pappmaché« eine Jugend, eine Generation, eine Zeit, die in unsere Gegenwart hineinreicht. Erzählerisch werden – seriellen Formaten nicht unähnlich – Stränge, Geflechte und Wendungen bemüht, um mosaikartig ein Bild aufzubauen.
Federers Stil stößt mir dabei allerdings immer wieder ungut auf: Dieses atemlose Bandwurm-Geplapper, distanziert und indirekt geschildert, filmisch schlicht bis gewollt sperrig und hässlich, trifft nicht meinen Geschmack.
Anzeige:
»Und alles wie aus Pappmaché« von Yannic Han Biao Federer umfasst 206 Seiten, erschien am 11.02.2019 bei Suhrkamp und kostet als Klappenbroschur 14,95 €.